Hören und Sprechen = Kommunikation
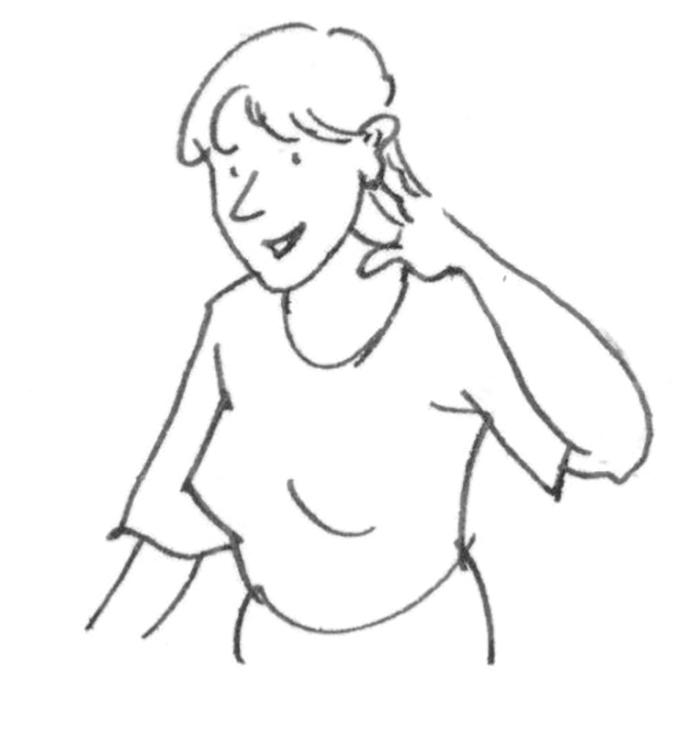
Gutes Hören ermöglicht über verbale Kommunikation überhaupt erst ein gemeinsames Miteinander. Wer gut hört, kann Informationen verarbeiten, interpretieren und Handlungen daraus ableiten. Gerade wenn es um zwischenmenschliche Kommunikation geht, zählen Sprachverständigung und -verständlichkeit ebenso zum Themenfeld „Hören“. Und ist das Hörorgan geschädigt, ist eine wichtige Bedingung für eine Zusammenarbeit in der Praxis eingeschränkt.
Nur begrenzt reparabel
Lärmschädigungen sind sowohl vom Schalldruckpegel, als auch von der Einwirkungsdauer abhängig. Je höher der Schalldruckpegel, umso kürzer die Zeit bis zur Schädigung und umgekehrt. Je länger die Beschallungszeit, desto geringere Schalldruckpegel reichen zur Schädigung aus. Das Innenohr kann nur begrenzt repariert werden. Insbesondere die feinen Zilien, die Haarzellen in der Ohrschnecke, die für die Aufnahme und Weitergabe von Geräuschen zuständig sind, können ihren Dienst aufgeben. Diese feinen Härchen bewegen sich entsprechend der Schallwellen hin und her. Die Zilien senden dann über Nervenimpulse die Information an das Hörzentrum des Gehirns. Die Aufnahme der Wellen ist ein mechanischer Vorgang. Durch das ständige Hin- und Herbewegen der Zilien (Härchen) kann es zu einer Erschöpfung und dann zu einer Überbelastung kommen. Die Folge: Die Zilien können Geräusche nicht mehr vollständig wahrnehmen. Sehr hohe Lautstärken verhalten sich dabei wie ein Sturm im Ohr. Die feinen Zilien können abbrechen – das Hörvermögen verschlechtert sich. Und leider können die abgebrochenen Härchen nicht wieder nachwachsen. Der eingetretene Hörschaden ist somit zeitlebend bleibend. Dieser ist vor allem am Anfang einer Überbelastung für den höheren Frequenzbereich zu erwarten (im Bereich von 4 Hz). Dann hat man eine Art Taubheitsgefühl im Ohr. Auch kann sich schon leichtes „Klingeln“ und „Pfeifen“ einstellen. Tatsächlich hören auch Menschen dieses Geräusch, wenn hierfür keine Schallwellen verantwortlich sind, sondern psychische Gründe vorliegen. In beiden Fällen steht der Körper unter Stress: Laute Geräusche werden zu lange gehört, hohe Belastungen treffen zu lange auf den Menschen ein. Es fehlt Ruhe – in jeder Hinsicht.
Botschafter Gehör
Das Gehör ist ein Botschafter, wenn etwas mit uns oder unserer Umgebung nicht stimmt. In Praxen können verschiedene Lärmquellen nerven:
- hoher Schallpegel des Fräsers und der Absaugung;
- ständiges Reden durch Patienten, Kolleginnen oder Besucher;
- ständiges Klingeln der Praxistür oder des Telefons.
Häufig sind ständige Unterbrechungen – verbunden mit Gesprächen und informationshaltigen „Zurufen“ – Ursache für den Anstieg des eigenen Stresspegels. Denn nichts ist wichtiger für die störungsfreie Arbeit wie eine selbstbestimmte, konzentrierte Planung des eigenen Arbeitsablaufs. Ein gelungener, entspannter Praxisalltag basiert auch darauf, dass Gehörtes verstanden und vereinbarungsgemäß umgesetzt wird. Beim Thema Hören und Lautstärke geht es in der Praxis also eher darum, ob konzentriertes, ruhiges Arbeiten möglich ist. Dauerschallpegel oder sehr hoher Impulslärm sind hier weniger zu erwarten.
Arbeitsschutz und Gesundheit
Ob aus Schall eine Gefahrenquelle wird, entscheidet der Schallpegelmesser – ab 85 dB(A) Lärmarbeit – und ihre individuelle Betrachtung. Bekanntermaßen sieht gerade der Arbeitsschutz vielfältige Möglichkeiten vor, künstlich erzeugten Lärm – also störenden Schall – zu vermindern oder zu vermeiden. Allen voran mit technischen Möglichkeiten, wie zum Beispiel geräuscharme Geräte. Mit „Rosa Rauschen (1/f-Rauschen)“ wird beispielsweise ein Verfahren bezeichnet, mit dem ein Dauerschallpegel am Arbeitsplatz erzeugt wird. Diese Schallwellen mit einem Schallpegel um 60 dB(A) sorgen dafür, dass einzelne sehr laute Impulse durch Telefonate, lautes Sprechen, Schreie, Rufe relativiert und nicht mehr als so störend empfunden werden. Klar: Je leiser ein Arbeitsraum ist, desto empfindlicher reagieren die Ohren auf plötzliches Telefonklingeln. Rosa Rauschen wird übrigens auch im Flugzeug, in Call Centern und in Wartehallen eingesetzt. Dies wäre allerdings für die Fußpflegepraxis zu hoch aufgesetzt. Hier helfen organisatorische Regeln in kleinen Teams, Belästigungen durch Schall zu mindern oder zu vermeiden.
Praxisraum
Der Umgang mit informationshaltigen Gesprächen und ständigen Unterbrechungen ist ein Thema, das in die nächste Teambesprechung gehört. Hören und Sprechen funktionieren dann besonders gut, wenn dafür passende Räume und Zeiten festgelegt sind. So sollten Besprechungen beispielsweise möglichst anlassbezogen zu festen Zeiten in einer ruhigeren Umgebung stattfinden. Um Störungen zu vermeiden, kann ein simples Schildchen an der Tür angebracht sein oder es gibt die Möglichkeit eines patientenfreien Zeitfensters. Ohne diese geeigneten Rahmenbedingungen finden Hören und Sprechen zwischen „Tür und Angel“ statt. Ob über das Hören eine Botschaft verstanden und akzeptiert wird, ist dann fraglich. Eine Vereinbarung, wann während der Behandlung durch Telefon oder Klopfen und Eintritt in das Behandlungszimmer gestört und gesprochen werden darf, gehört ebenso in den persönlichen Maßnahmenkatalog für ruhiges Arbeiten in der Praxis. Als simples Beispiel ist die Vereinbarung einer Praxisgemeinschaft zu sehen, konsequenter die Türen zu schließen, dies leise zu tun und nicht einfach zufallen zu lassen. Gleichwohl macht es Sinn, auch technische Lösungen im Blick zu behalten. So kann die Waschmaschine, aufgestellt auf Anti-Rutschmatten und versehen mit einer zusätzlichen Dämmung an der Rückwand durchaus für wohltuende Ruhe im Flur sorgen. Das Anbringen von Schaumstoff auf der Rückseite von aufgehängten Bilderrahmen dient ebenso der Senkungen des dB(A)-Schallpegels, beispielsweise im Bereich der Empfangstheke.
Anschrift der Verfasserin:
Hildegard Schmidt
ErgonomieCampus
An der Beuster 5 B
31199 Diekholzen
www.ergonomiecampus.de
- BAuA, Gesundheitsschutz – Lärmwirkungen, Gehör, Gesundheit, Leistung, 11. Auflage. Download oder Broschüre: http://www.baua.bund.de
- Fa. Org-Delta, Akustikkonzepte für Umgebungen mit informationshaltigen Geräuschen, http://www.org-delta.de
- INQA, BAuA Lärm in Bildungsstätten – Lärmminderungskonzepte und Hintergrundinformation. http://www.inqa.de «
- BAuA, Gesundheitsschutz – Lärmwirkungen, Gehör, Gesundheit, Leistung, 11. Auflage. Download oder Broschüre: http://www.baua.bund.de
- Fa. Org-Delta, Akustikkonzepte für Umgebungen mit informationshaltigen Geräuschen, http://www.org-delta.de
- INQA, BAuA Lärm in Bildungsstätten – Lärmminderungskonzepte und Hintergrundinformation. http://www.inqa.de «





